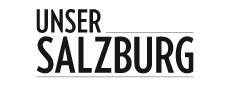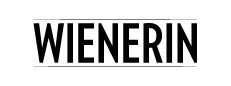Fortissima: Cellistin Raphaela Gromes im Talk
Cellistin Raphaela Gromes über ihre Leidenschaft
© Gregor Hohenberg
Sie ist eine weltweit gefeierte Musikerin: die Cellistin Raphaela Gromes. In ihrem soeben erschienenen Doppelalbum „Fortissima“ hebt sie den musikalischen Schatz virtuoser Komponistinnen, deren Werke längst vergessen sind – und erobert damit gleich Platz 1 der deutschen Klassikcharts. Ein Manifest weiblicher Ausdruckskraft. Laut, kraftvoll und kompromisslos.
Cellistin Raphaela Gromes über ihre Leidenschaft
Bereits ihr Album „Femmes“ wurde vom Publikum gefeiert. In „Fortissima“ präsentiert sie verschollene Werke, wie das Cellokonzert der deutsch-jüdischen Komponistin Maria Herz, das im Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus um seine Uraufführung und gebührende Anerkennung gebracht wurde. Oder das vermutlich erste Cellokonzert einer Frau von Saint-Saëns-Schülerin Marie Jaëll, deren unterschätztes Talent schon Franz Liszt in einem Brief beschrieb: „Ein Männername über Ihrer Musik und sie wäre auf allen Klavieren“. Zudem erklingt – als Weltersteinspielung – eine Ballade für Cello und Orchester von Elisabeth Kuyper.
Frau Gromes, wie kam es zu dieser leidenschaftlichen Spurensuche?
Fortissima ist im Grunde die konsequente Weiterführung meines Albums Femmes von 2023. Schon damals habe ich Komponistinnen in den Mittelpunkt gestellt, deren Musik kaum bekannt ist. Die große Resonanz auf Femmes hat mir gezeigt, wie viel Offenheit und Neugier beim Publikum vorhanden ist – und dass es sich lohnt, tiefer zu graben. Bei Fortissima wollte ich den Blick erweitern: hin zu großformatigen Werken, zu Cellokonzerten und Sonaten. Für mich war entscheidend zu zeigen, dass Komponistinnen nicht nur Miniaturen oder Charakterstücke geschrieben haben, sondern substanzielle, groß angelegte Werke mit eigener Tonsprache und Ausdruckskraft. Die Lebensgeschichten dieser Komponistinnen haben mich so berührt und aufgerüttelt, dass ich meine eigene Entdeckungsreise hin zu ihnen in einem Buch festhalten wollte. („Fortissima“ im Goldmann Verlag für € 24.)
Warum wurden diese Komponistinnen systematisch übergangen?
Es lag nicht an mangelndem Talent, sondern an Strukturen, die Frauen über Jahrhunderte den Zugang zu Ausbildung, Veröffentlichung und Aufführung verboten haben. Wer keine Verleger oder Dirigenten an seiner Seite hatte, konnte kaum eine Karriere aufbauen. Dadurch blieben viele Werke unveröffentlicht und wurden mit der Zeit vergessen. Die Geschichtsschreibung hat diese Auslassungen weitgehend übernommen. Der Kanon war von Beginn an männlich geprägt – in Lehrplänen, Archiven, Konzertprogrammen. Wenn eine Frau komponierte, galt sie oft als Ausnahmefall. Ich sehe es als Aufgabe meiner Generation, diesen Kanon zu hinterfragen und ihn um Perspektiven zu erweitern, die lange fehlten.
Werden Sie weitere Werke dem musikalischen Vergessen entreißen?
Ja, das möchte ich. Viele der Stücke auf Fortissima existierten nur in Handschriften oder fragmentarischen Fassungen. Gemeinsam mit meinem Pianisten Julian Riem habe ich Quellen verglichen, ergänzt und in einigen Fällen neu ediert, etwa das Cellokonzert von Marie Jaëll, dessen tieftrauriger zweiter Satz erst kürzlich wiederaufgefunden wurde, oder die Ballade von Elisabeth Kuyper, die Julian vom Klavierauszug für Orchester rekonstruieren musste, weil die Partitur und die Stimmen verschollen sind. So konnten wir von diesem Stück eine Weltersteinspielung vornehmen. Besonders wichtig ist mir dabei auch die Zusammenarbeit mit Verlagen, damit andere Musikerinnen und Musiker diese Werke künftig spielen können. Die Sonate von Henriëtte Bosmans erschien nun etwa mit unseren Bezeichnungen beim Henle Verlag, das Cellokonzert von Marie Jaëll und die Sonate von Emilie Mayer bei Furore, Elisabeth Kuyper bei Simrock. Durch diese Kooperationen werden die Stücke endlich zugänglich – und können hoffentlich bald Teil des regulären Konzertrepertoires werden. Diese editorische Pionierarbeit gehört für mich untrennbar zur künstlerischen Verantwortung dazu.
Rebecca Dales Orchesterwerk „Femmage“ hingegen wurde sogar eigens für Sie geschrieben…
Ja, das war eine sehr besondere Zusammenarbeit. Ich hatte Rebeccas „Requiem for my Mother“ gehört und war tief bewegt von der emotionalen Tiefe, persönlichen Sprache und Klarheit ihrer Musik. Ich habe sie daraufhin kontaktiert, und sie kam in ein Konzert von mir in London. Sie war so begeistert von meinem „singenden“ Celloton, dass sie mir unbedingt Melodien schreiben wollte, die diesen Klang tragen. So entstand „The lost composers – Fortissima“ für Cello und Orchester. Nur drei Tage vor der Aufnahme mit dem deutschen Sinfonie-Orchester Berlin – hat sie uns noch „Radiance“ geschickt, das als Zugabe gedacht war. Sie war bei der Aufnahme in Berlin anwesend, und für mich war es eine neue, intensive Erfahrung, mit einer Komponistin direkt an einem Werk zu arbeiten. Diese Form des Austauschs, das unmittelbare Gestalten gemeinsam im Studio, war etwas ganz Besonderes.
Als Abschluss wird ein orchestrales Cover von P!NKs Hymne „Wild Hearts Can’t Be Broken“ erklingen. Sehen Sie darin einen Auftrag an die Zukunft?
Durchaus! Dieses Stück steht für Selbstbestimmung und innere Stärke – Themen, die auch Fortissima durchziehen. Ich wollte zeigen, dass sich diese Haltung nicht auf eine bestimmte Epoche oder Gattung beschränkt. Eine starke Aussage kann ebenso in einer Sonate von Emilie Mayer wie in einem Song von P!NK stecken. Mir geht es dabei um eine Haltung: Musik darf Grenzen überschreiten, sie darf gegenwärtig sein und gesellschaftlich reagieren. „Wild Hearts Can’t Be Broken“ ist für mich ein Symbol dafür, dass „Fortissima“ nicht rückwärtsgewandt ist, sondern den Blick nach vorne richtet.
_____________
Das könnte dich auch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
People
6 Min.
Vom Dorftratsch auf die große Bühne
Michael Steiger über Heimatgefühl, Humor als Überlebensstrategie und den Mut, eigene Wege zu gehen.
Endlich hat der Manfred der Marlene einen Heiratsantrag gemacht! Und über 17.000 Follower haben dies zwischen den Weihnachtsfeiertagen auf Social Media mitverfolgt. Wer Michael Steiger (@michidersteiger) bereits kennt, weiß, wovon ich spreche. Wer nicht, der sollte dieses Interview umso genauer lesen. Wir treffen den 26-Jährigen an einem frühen Nachmittag in einem Café in der Eisenstädter … Continued
6 Min.
Mehr zu People