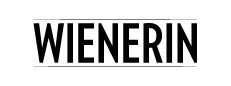Fluchtforscherin Judith Kohlenberger: Wie wir unsere Demokratie stärken können
Empathie nur für die Meinigen?!
© Vandehart Photgraphy
Die preisgekrönte Fluchtforscherin Judith Kohlenberger legt zwei neue Bücher vor und erklärt, wie wir unsere Demokratie an Europas Grenzen gefährden und warum streiten mit „anders“ denkenden Familienmitgliedern ein Friedensbeitrag ist.
Vielleicht haben Sie davon schon gehört oder gelesen: Tendenziell überleben mehr Männer die Flucht über das Meer im Schlauchboot. Nicht selten wird hierzulande gemutmaßt, das hätte geschlechterhierarchische Gründe. Das Gegenteil ist der Fall. Männer platzieren sich in den Booten an der Außenseite, um Frauen in der Mitte vor hohen Wellen zu schützen. Doch die Boote werden durch Schlepper massiv überladen, sie senken sich, es schwappt mehr und mehr Wasser hinein, und die Dämpfe des mitgeführten Benzins betäuben die Frauen, sodass sie häufig bewusstlos zu Boden sinken.
Andreas, 60, ist Wirtschaftswissenschaftler und erfolgreicher Unternehmer; er half mehrere Wochen an Bord des Rettungsschiffs Aquarius. Seine letzte Fahrt wird seine eindringlichste. In einem gekenterten Boot entdecken die Seenotretter:innen, zu denen er gehört, Dutzende ausschließlich männliche Überlebende in teils schlechtem Gesundheitszustand – aber auch 23 Tote: 22 Frauen und einen Mann.
„Die tödliche Kombination aus Treibstoff, Wassereintritt und rutschigem Gummiboden machte auch die von der Aquarius gefundenen Frauen chancenlos: Alle 22 waren im Boot und nicht außerhalb dessen ertrunken“, beschreibt Judith Kohlenberger in ihrem jüngst erschienenen Essay „Grenzen der Gewalt“ (Leykam). Nahezu zeitgleich veröffentlichte sie außerdem das Sachbuch „Gegen die neue Härte“ (dtv). Und zwar nur zwei Jahre nachdem die Migrationsforscherin an der WU (Department Sozioökonomie) „Das Fluchtparadox“ (Kremayr & Scheriau) schrieb.
Verhärtung ist nur eine vermeintliche Überlebensstrategie, denn wir brauchen einander, wir hängen voneinander ab.
Judith Kohlenberger
Schon wieder dieses Thema? Ja und nein. Es geht um Flüchtende. Um Menschen, die auch dort sterben, wo viele von uns den Sommerurlaub verbringen. Das Mittelmeer sei zu einem „Grab für Männer, Frauen und Kinder“ geworden, klagt auch Papst Franziskus seit Jahren immer wieder. Es geht aber nicht um Flüchtende allein. Parallel wurden Prozesse in Gang gesetzt, die die Gesellschaft und die Demokratie bedrohen – und unseren Frieden.
Welche Gefahren lauern, die wir bald nicht mehr wegschieben werden können, beschreibt Judith Kohlenberger in ihren beiden neuen Büchern. Und auch, wie wir da wieder herauskommen können.
Zwei Bücher zeitgleich zu Flucht – wieso?
Judith Kohlenberger: In „Grenzen der Gewalt“ richte ich den Blick auf die Grenzen: Was passiert mit den Menschen, die ankommen, aber auch mit denen, die Menschen aufnehmen oder zur Abwehr abbestellt sind. Es geht um den „Gürtel der Gewalt“, der Europa säumt.
Ich habe das bewusst persönlich angelegt, es kommen meine Verbindungen zu Flucht und Vertreibung, mein Aufwachsen im burgenländischen Grenzgebiet vor. „Gegen die neue Härte“ ist ein Sachbuch; hier geht es darum, was die Grenzgewalt in den letzten zehn Jahren mit dem Inneren der Gesellschaft gemacht hat. Meine These: Es wird nicht nur harte Kante gegen Asylsuchende gezeigt, es findet auch eine Verhärtung im Inneren statt, ein Abwenden vom Anderen, auch in Bereichen, die vordergründig nichts mit Migration zu tun haben.
Man schottet sich ab, zieht sich in die eigene Blase zurück. Beide Bücher beschreiben jeweils ein eigenes Phänomen, aber sie existieren, weil sie einander bedingen. Ich verstehe die Bücher stark in Konversation miteinander.
Sie sind höchst fesselnd, aber wir leben in einer Zeit, in der viele keine Nachrichten mehr hören möchten. Wie bringen Sie die Menschen dazu, diese Bücher zu lesen?
„Das Fluchtparadox“ wurde „Wissenschaftsbuch des Jahres“, es war für den deutschen Sachbuchpreis nominiert, und es wurde gekauft und gelesen; das hat mich bestärkt. Es gibt einen Bedarf, zu verstehen und auch Lösungswege aufzuzeigen, die sich nicht erschöpfen in „Festung Österreich“ oder „Festung Europa“. Denn dabei handelt es sich nur um Scheinlösungen, die genauso wenig funktionieren wie das Auslagern von Flüchtlingen in Drittstaaten, nach dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“.
Ich gebe im Buch den Begegnungen mit Grenzpolizist:innen viel Raum, sie sehen das Thema erstaunlich differenziert und haben mir vieles widergespiegelt, was ich aus der Forschung kenne. Ein Beamter sagt: „Wir können kontrollieren und Zäune bauen, so viel wir wollen. Wenn wir nicht die Fluchtursachen angehen, werden immer mehr Leute kommen.“ Es wäre sehr wichtig, dass die Politik den Menschen aus der Praxis zuhört.
Dieser Polizist, den ich noch dazu aus meiner Schulzeit kenne, hat eine Gegenerzählung zum kolportierten Kontrollverlust. Er betont: Unsere Exekutive verkörpert den Rechtsstaat, jede:r Migrant:in wird registriert und identifiziert. – Wer von Chaos an der Grenze spricht, redet eigentlich die Arbeit der Polizei schlecht.
Parallel zur „neuen Härte“, wie Sie sie beschreiben, ist es gesellschaftstauglich geworden, sich feinfühlig zu zeigen. Wie geht sich das aus?
Wenn man sich dieses Phänomen genauer anschaut, etwa psychische Belastungen offen zu zeigen, erkennt man, dass das stark an die eigene Blase gerichtet ist. Vieles spielt sich im virtuellen Raum ab; der Algorithmus sorgt zusätzlich dafür, dass der Austausch nur unter den „eigenen“ Leuten stattfindet. Die vermeintliche Offenheit wirkt häufig nicht über die eigene Blase hinaus.
Ich bin mit FPÖ-Wähler:innen in meinem familiären Umfeld aufgewachsen und musste früh entscheiden, wie ich damit umgehe. Denn fast alles, wofür ich stehe, richtet sich gegen das, was die Partei vertritt. Aber rund 30 Prozent der Österreicher:innen wählen die FPÖ, natürlich sind das auch unsere Onkel, Tanten und Cousins. Ich glaube nicht, dass für irgendeine Seite etwas gewonnen wäre, auch nicht für den Flüchtling an der Grenze, wenn ich diese Menschen bei der Familienfeier meide.
Man kann auf seine Werte beharren und aussprechen, womit man nicht einverstanden ist, aber die grundsätzliche Zugewandtheit sollte bleiben.
Also lieber streiten?
Demokratie ist nichts anderes als diszipliniertes Streiten; ich habe das in meiner Familie gut gelernt. Und auch auszuhalten, dass man bei einem Thema auf keinen grünen Zweig kommt, aber sich trotzdem gern hat. So wie bei manch einem jugendlichen Geflüchteten ein Diebstahl aus seiner Biografie genährt ist, verhält es sich auch bei Menschen, die offen für rechte Ideen sind. Das ist in beiden Fällen keine Entschuldigung, aber eine Art der Erklärung, um eine gewisse Grundempathie aufrechtzuerhalten.
Empathie als begrenzte Ressource nur für die Meinigen – dieses Rezept taugt nicht. Ich bin weder für komplett offene noch für komplett geschlossene Grenzen – auch nicht im Zwischenmenschlichen. Man muss eine gewisse Offenheit bewahren, um den anderen nahekommen zu lassen. Gleichzeitig muss man Grenzen setzen können, wenn es übergriffig wird. Dieses Austarieren der Grenzen ist uns leider abhanden gekommen.
Das könnte dich auch interessieren
- Geschlechtervielfalt: “Wir sind sehr viel”
- Stutenbissigkeit: Die letzten Zuckungen des Patriacharts
- Gender Health Gap: Warum Medizin Frauen benachteiligt
Sie haben kürzlich in Ihrem Podcast „Aufnahmebereit“ Elfriede Jelinek zitiert: „Ich höre ein Ungeheuer atmen.“ Ihr Gast war die preisgekrönte Journalistin Susanne Scholl, die sinngemäß dazu sagte: Der größte Fehler nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass er in ganz Europa nicht aufgearbeitet wurde. Hat die gegenwärtige Verhärtung damit zu tun?
Leider gibt es eine gewisse Kontinuität; gerade Österreich hat sehr spät mit der Aufarbeitung der NS-Zeit begonnen und macht es sich beim neu erstarkten Antisemitismus zu leicht, indem er „den Anderen“ zugeschoben wird. Bezeichnend für die aktuelle Situation finde ich, dass sowohl antisemitische als auch antimuslimische Vorfälle gestiegen sind.
Es geht immer um „das Andere“, um „das Fremde“. Unsere Empathie kann und darf keine begrenzte Ressource sein. Frei nach Hannah Arendt ist es unsere Kernaufgabe, allen Menschen ihre Menschlichkeit zuzugestehen. Die Negation dieser Menschlichkeit ist ein Einfallstor: Es beginnt bei „Fremden“, bei Geflüchteten, Obdachlosen, Homosexuellen – und setzt sich endlos fort.
Irgendwann kommen Menschen mit Behinderungen dran und dann Frauen, die gar keine Minderheit sind, aber eben nicht Teil der männlichen Norm.
Woher kommt die „neue Härte“?
Ich habe die Härte als eine kulturelle Technik beschrieben, ohne sie zu entschuldigen. Die Pandemie, die massive Beschleunigung und all das, was gerade passiert, führen laut dem deutschen Soziologen Steffen Mau zu einer „Veränderungserschöpfung“. Algorithmen treiben uns noch weiter auseinander. Der Austausch mit dem „Anderen“ kann irritieren, das braucht eine gewisse Grundtoleranz, das stört und erschöpft – der Grundimpuls von vielen ist es da zuzumachen.
Das mag menschlich sein, aber es schadet uns; die Verhärtung ist nur eine vermeintliche Überlebensstrategie, denn wir brauchen einander, wir hängen voneinander ab. Es ist gerade die Zuwendung, die uns sicherer machen kann. Nur wenn ich mein Gegenüber im Blick habe, kann ich Grenzen austarieren. Wenn ich Zugewandtheit lebe, kann ich vom Positiven profitieren, von Inspiration und Innovation beispielsweise. Wenn eine Grenzüberschreitung passiert, kann ich diese besser navigieren.
Ist unsere Demokratie bedroht?
Ja, diese These stelle ich stark in den Raum; ich habe das schon beim „Fluchtparadox“ getan und jetzt wieder: Was an den Grenzen passiert, hat Auswirkungen auf die Demokratie im Inneren. Das ist die Einflugschneise. Wir sehen das in Ländern wie Polen und Ungarn, wo die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten werden. Gleichzeitig passieren Einschnitte bei LGBTQI-Rechten, bei der Presse- und Medienfreiheit, bedroht sind die Unabhängigkeit der Justiz und die reproduktiven Rechte der Frauen.
Wir verstehen die Fluchtforschung auch als Demokratieforschung. An der Grenze wird die Demokratie nach ihren Werten und Prinzipien befragt. Wie wir mit denen umgehen, die von außen kommen, sagt etwas darüber aus, wie wir im Inneren miteinander leben. Plakativ ausgedrückt: Wenn wir die Politik der Abschottung und Abschreckung weiterführen, schaffen wir ein Europa, das auf einem Fundament der Gewalt und auf Leichen gebaut ist.
Irgendwann kommt das Ungemach der Welt so nahe, dass wir uns ihm nicht mehr entziehen können. Abwendung führt uns nur immer tiefer rein in die Misere.
Was bedeutet das für „unseren“ Frieden?
Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Wenn Beendigung des Konflikts eine der beiden Seiten mit dem Gefühl hinterlässt, sie wäre betrogen oder ungerecht behandelt worden, erreicht man keinen nachhaltigen Frieden. Wir haben das bei den „Black Lives Matter“-Demos gesehen: „No justice, no peace“ ist so banal wie wahr.
Nachhaltiger Frieden geht nur mit Gerechtigkeit – die Bedingung dafür ist die grundlegende Anerkennung der Gleichwertigkeit aller.