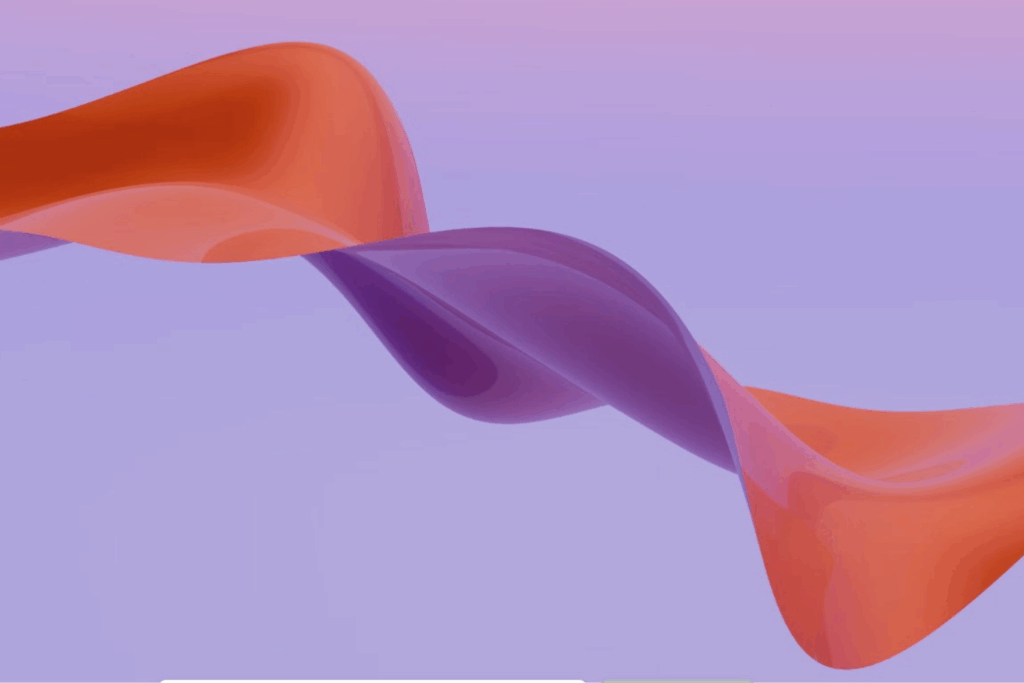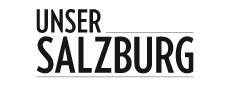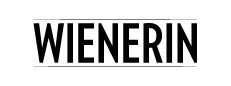ME/CFS: Leben mit dem Chronischen Fatigue Syndrom
Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen.
© Rodrigo Pereira / Unsplash
Stell dir vor, du hast täglich Schmerzen und musst dir deine Energie jeden Tag ganz bewusst einteilen, denn schon geringe körperliche oder kognitive Belastung kann deinen Zustand erheblich verschlechtern. Das ist das Leben mit dem Chronischen Fatigue Syndrom (ME/CFS). Wir haben mit einer Betroffenen und einer auf die Krankheit spezialisierten Psychotherapeutin gesprochen.
Was ist ME/CFS?
Stark eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, Brainfog, Reizempfindlichkeit – das sind nur einige der Symptome von Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom, kurz ME/CFS, einer schweren chronischen Multisystemerkrankung. Das charakteristische Hauptsymptom ist die Post-Exertional Malaise (PEM), eine Belastungsintoleranz, die eine Zustandsverschlechterung, einen sogenannten “Crash”, bereits nach geringer körperlicher oder kognitiver Belastung verursacht. Um das zu verhindern, ist es notwendig, dass ME/CFS-Erkrankte innerhalb der individuellen Leistungsgrenzen bleiben, und diese nicht überschreiten. Eine offizielle Zahl der Erkrankten in Österreich gibt es nicht; laut Schätzungen sind jedoch mehrere zehntausend Menschen betroffen. Die Mehrheit ist aufgrund der starken Symptome nicht arbeitsfähig, und viele sogar dauerhaft an Haus oder Bett gebunden oder pflegebedürftig. Rund zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen. ME/CFS bricht vor allem bei jungen Menschen zwischen 10-19 und 30-39 Jahren aus. Eine davon ist Madeleine Martos. Wir haben sie gemeinsam mit der Psychotherapeutin Romana Gilli, die Online-Gruppentherapien für Betroffene anbietet, zum Interview getroffen.
Wenn der Körper nicht macht, was man will
„Ich habe die vergangenen drei Tage extra viel Energie gespart, damit wir uns heute sehen können“, begrüßt uns Madeleine bei unserem Treffen. Die 36-Jährige erkrankte 2017 nach einer Infektion an ME/CFS, einer Krankheit, die ihr Leben und ihren Alltag massiv einschränkt. Kraftlosigkeit, Schmerzen oder Gedächtnisprobleme stehen an der Tagesordnung – mal mehr, mal weniger. Doch darüber zu sprechen, die Krankheit sichtbar zu machen, und auch die Notwendigkeit von gezielter therapeutischer Hilfe und Betreuung für Betroffene hervorzuheben, liegt ihr so sehr am Herzen, dass sie es in Kauf nimmt, auch die kommenden Tage nach dem Interview zuhause zu verbringen, um sich von der Anstrengung, die das Gespräch für sie bedeutet, zu erholen.
An Madeleines Seite: Romana Gilli. Die Verhaltenstherapeutin ist Gründerin der „Therapie Mühle“ und hat sich damit speziell auf Online-Gruppentherapien für ME/CFS-Betroffene und Long-Covid-Patientinnen und -Patienten spezialisiert, und damit das österreichweit erste Online-Gruppentherapieangebot geschaffen. Denn was vielen nicht bewusst ist: das Haus zu verlassen, um zur Therapie zu gehen, ist für viele Betroffene oft einfach nicht möglich, da sie nicht die Kraft dazu haben.
Die „Therapie Mühle“
Das Projekt ist unter anderem entstanden, weil die Therapeutin die Erfahrung gemacht hat, dass es bei vielen Menschen, die wegen unterschiedlicher Themen für längere Zeit in stationärer Behandlung waren, oftmals Bedarf für langfristige Unterstützung gibt, und „weil viele zum Beispiel wegen körperlicher Erkrankungen nicht die Möglichkeit haben, in eine Therapie zu gehen“. Darunter eben auch ME/CFS-Betroffene, so Gilli. In Gruppensitzungen von etwa 45 Minuten unterstützt sie nicht nur ME/CFS- sondern auch Long-Covid-Patientinnen und -Patienten dabei, wieder Halt im Leben zu finden und belastende Themen zu verarbeiten.
Auch die Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer selbst profitieren voneinander, indem sie sich über gemeinsame Herausforderungen austauschen und gegenseitig bestärken können. In Kleingruppen von bis zu zehn Klientinnen setzt Romana Gilli verschiedene Übungen ein. Es geht unter anderem ganz klar darum zu schauen, „wie komme ich wieder in die geistige Aktivierung, und wie kann ich meine Energie einteilen, von der wenigen, die ich noch habe“, erklärt sie. Sie betont auch, dass es besonders wichtig ist, sich bei der Arbeit mit ME/CFS-Patientinnen und -Patienten vor allem auch die emotionale Komponente anzuschauen, die ihre Energielevels zusätzlich schwächen kann. Neben ihrer täglichen Auseinandersetzung mit der Krankheit kämpfen viele Betroffenen nämlich auch noch damit, sich ständig für ihre Symptome rechtfertigen zu müssen. Oder andere überhaupt erst davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich an einer ernstzunehmenden Krankheit leiden.
Kampf um Sichtbarkeit von ME/CFS
Auch Madeleine kennt die Situation, dass sie um die Anerkennung ihrer Krankheit kämpfen muss und ihre körperlichen Symptome nicht ernst genommen werden, nur allzu gut. „Heute ist ein Tag, den habe ich vielleicht alle drei Wochen. Ich habe auch die letzten Tage absichtlich Pause gemacht, damit ich heute da sein kann. Und ich weiß, ich muss die nächsten Tage Pause machen. Was du heute siehst, ist sozusagen die Essenz aus dem. Natürlich freue ich mich über solche Tage und unternehme etwas, und gehe dann aber auch mal über meine Grenzen, weil ich mir denke ‚egal‘! Genau das ist aber auch ein bisschen das Problem. Die Leute sehen mich und sagen ‚es passt ja eh alles!‘ – dass das aber ein Prozent meiner Zeit ist, das sehen sie nicht“. Es sei oft schwierig, anderen verständlich zu machen, was die Krankheit für Betroffene bedeutet, erklärt Madeleine.
Ich bin mehr als nur die Erkrankung!
Madeleine Martos
Hinzu kommt, dass sie nicht ständig über ihre Symptome sprechen will, sondern einfach nur als Mensch wahrgenommen und nicht über ihre Krankheit definiert werden: „Ich werde die Leute nicht einladen, wenn ich einen schlechten Tag habe und in einem dunklen Zimmer lebe. Und ich poste davon auch keine Fotos, weil das nicht das ist, was mich ausmacht. Und damit sagen die Leute dann aber: ‚gibt’s nicht!‘“.
Aus diesem Grund war Psychotherapie für Madeleine besonders wichtig. Und „um das erste Mal in meinem Leben auch anzuerkennen, was ich spüre“, erzählt sie. Auch sie ist der Teil der Gruppensitzungen von Romana Gilli und hat dort schon viele positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß dank der Gruppe, dass es nicht nur mir so geht. Denn man fängt teilweise nämlich an, sich selbst zu gaslighten und denkt sich oft: ‚vielleicht bin ich nur wehleidig, vielleicht bilde ich mir das alles ein?‘“. Dass sich auch andere Betroffene in ähnlichen Situationen und emotionalen Belastungsphasen wiederfinden, kann bestärkend sein, weiß auch Gilli.
Therapie als Sicherheit
„Es gibt durch die Therapie ein gemeinsames Ziel“, betont die Psychotherapeutin. Sie hat sich bereits sehr intensiv mit der Krankheit, ihren Symptomen und der psychischen Belastung, die diese mit sich bringen, auseinandergesetzt. Durch ihre Erfahrung mit Betroffenen weiß sie, dass Psychotherapie viel Tagesstruktur, Sicherheit und eine Konstante bieten kann und auch dabei hilft, mit den Symptomen der Krankheit besser umzugehen. „Ich kann niemanden heilen, aber ich kann dabei unterstützen, zu verstehen, wie mein Nervensystem und mein Stresssystem funktionieren, worauf man achten muss, und was man verändern kann, um eben zum Beispiel Stressreduktion herbeizuführen, und wie ich mein Nervensystem am besten beruhigen kann, um eben keine Verschlechterung zu haben. Wenn ich das verstanden habe, dann ist Psychotherapie sinnvoll. Und auch, um zu akzeptieren, dass die Erkrankung da ist und wie ich damit umgehen kann“, so Gilli.
Wie wichtig das Thema Therapie für ME/CFS-Patientinnen ist, ist laut ihr allerdings noch längst nicht genug verbreitet. Hinzu kommt, dass oftmals falsche Schlüsse gezogen werden, wenn eine Krankheit nicht sofort auf körperliche Ursachen zurückgeführt werden kann, und dann alleine die Psyche dafür verantwortlich gemacht wird.
„Ich fühle mich gefangen in meinem Körper“
Der Weg zur Diagnose war auch für Madeleine lang. Nicht selten wurde ihr vorgeworfen, sie würde simulieren oder sei einfach zu faul, um zu arbeiten. Dabei wäre Madeleine nichts lieber, als aktiv sein zu können, ohne über ihr Energielevel und ihre Leistungsgrenze nachdenken zu müssen. „Ich fühle mich oft gefangen in meinem Körper“, so Madeleine und erzählt, was sie am liebsten alles umsetzen würde. Doch ihr Körper macht nicht mit. Damit, sowie mit der fehlenden Anerkennung der in der Gesellschaft scheinbar unsichtbaren Krankheit, für die sich auch in der Medizin nur wenige zuständig fühlen, kämpfen viele Betroffene.
Dabei ist ME/CFS alles andere als eine unbekannte Krankheit und bereits seit 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert. Allerdings wurde sie bis heute nicht ausreichend beforscht, weshalb es „aktuell (noch) keinen isolierten Biomarker gibt“, wie die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS auf ihrer Webseite betont. Es brauche dringend mehr biomedizinische Forschung, und „eine medizinische Versorgung der Betroffenen kann und muss endlich etabliert werden“, heißt es dort weiter. Auch mit dem vorherrschenden Vorurteil, ME/CFS sei eine psychische Erkrankung, müsse man dringend aufräumen.
Das Stigma aufbrechen
Umso wichtiger ist es, dass Betroffene wie Madeleine Martos offen über ihre Krankheit sprechen und Therapeutinnen wie Romana Gilli aktiv dabei unterstützen, für mehr Anerkennung in der Gesellschaft zu sorgen. Was sich Madeleine am Ende unseres Gesprächs ganz besonders wünscht: „Es wäre großartig, wenn wir aufhören würden, uns gegenseitig zu bewerten. Wenn Menschen mich nicht bewerten würden, dann würden sie nicht mehr den Kopf schütteln, wenn ich am Behindertenparkplatz stehe und ganz normal aus dem Auto steige. Sie würden keine Kommentare dazu abgeben, dass ich im Rollstuhl sitze und mir sagen, ich bin übergewichtig. Sie würden aber gleichzeitig auch nicht anzweifeln, dass ich mehr bin, als nur die Erkrankung.“
Nähere Informationen zur Therapie Mühle unter www.therapiemuehle.at
WE&ME FOUNDATION
Diese Bilder von Madeleine Martos und ihrem Mann Daniel, sowie weiteren ME/CFS-Betroffenen und Angehörigen, sind im Rahmen eines Fotoprojekts von Starfotografen Brent Stirton auf Initiative der 2020 von der Familie Ströck gegründeten WE&ME-Stiftung entstanden. Sie zeigen den Alltag von Betroffenen und das Leben mit ME/CFS. Die Stiftung setzt sich unter anderem dafür ein, die Forschung zur Krankheit voranzutreiben. Nähere Informationen unter www.weandmecfs.org
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen_____________
Das könnte dich auch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
8 Min.
Cortisol ist nicht der Feind
Warum Cortisol unseren Alltag steuert und wie wir lernen, im richtigen Rhythmus zu leben.
Fühlt man sich oft gestresst, müde oder gereizt, kann das viele Ursachen haben. Eine davon: ein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht. Mit diesen fünf Tricks habe ich mein Cortisol gesenkt!“ – „So bringst du dein Stresshormon runter!“ – „In nur einer Woche bin ich mein Cortisol-Face losgeworden!“ So oder so ähnlich beginnen viele Videos, die auf TikTok … Continued
8 Min.
Lifestyle
2 Min.
Laufen im Winter? Klappt super – mit diesen 6 Tipps.
Warm, Sichtbar, Sicher.
Lieber langsam als frierend Im Winter lohnt es sich, das Tempo bewusst zu drosseln. So atmet man weniger kalte Luft ein und bleibt stabil – besonders auf nassen oder vereisten Strecken. In Kurven oder bergab gilt: kürzere Schritte, weniger Risiko. Auch die Laufdauer sollte nicht übertrieben werden. Kälte setzt dem Körper mehr zu als man … Continued
2 Min.
Mehr zu Gesundheit