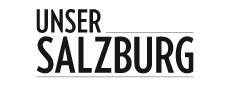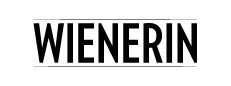“Die Sprache der Göttinnen”: Venus von Willendorf trifft auf die Kunst der Gegenwart
Eine Sonderausstellung im MAMUZ
© Josef Schimmer
Als Figurinen, Skizzen oder Fotografien – in der von Elisabeth von Samsonow und Katharina Rebay-Salisbury kuratierten Ausstellung treffen archäologische Funde und die Kunst der Gegenwart aufeinander.
Sonderaustellung “Die Sprache der Göttinnen”
Urgeschichtliche Frauendarstellungen, überwiegend aus Österreich, treffen auf Werke von Künstlerinnen der Gegenwart – das erwartet Besucherinnen und Besucher der Sonderschau „Die Sprache der Göttinnen“ im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya. Kuratiert wurde die Ausstellung von Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow und Archäologin Katharina Rebay-Salisbury, die damit unter anderem zeigen wollen, welche nachhaltigen Einflüsse urgeschichtliche Darstellungen des Weiblichen auf die moderne Kunst der heutigen Zeit haben. Nicht nur die berühmten Venus-Statuetten, wie etwa die Venus von Willendorf, sind in der Ausstellung zu sehen, sondern auch Skizzen und Fotografien, unter anderem von Schiele oder Judy Chicago. Wir haben mit den beiden Kuratorinnen über die Sonderschau und ihre gemeinsame Intention dahinter gesprochen.
Die Kuratorinnen von “Die Sprache der Göttinnen” im Interview
Frau von Samsonow, die Ausstellung ist eine Zusammenstellung von archäologischen Funden mit zeitgenössischer Kunst – was erwartet Besucherinnen und Besucher?
Elisabeth von Samsonow: Wir haben versucht, eine Ausstellung mit einer Ausstrahlung und Atmosphäre zu entwickeln, die beiden Werktypen Raum lässt, sie aber zugleich in ein Zwiegespräch einbindet. Das Besondere an der Ausstellung ist ja, dass sie zeigt, wie die wunderbaren einfachen, aber so überlegen eingesetzten Formen und Linien der urgeschichtlichen und jungsteinzeitlichen Figuren wiederkehren im Vokabular der bildenden Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts. Man sieht tatsächlich das, was wir die „Sprache der Göttinnen“ nennen, ein Esperanto des Weiblichen und der mit ihm in Verbindung stehenden Angelegenheiten. Außerdem bietet die Ausstellung einen Einblick in die einschlägigen stattlichen Sammlungen von Archaeologica in österreichischen Institutionen. Es gibt ja auch weniger bekannte weibliche Figurinen von großer Schönheit und Perfektion aus Niederösterreich.
Frau Rebay-Salisbury, welche Bedeutung haben die urgeschichtlichen Frauendarstellungen für die Archäologie und wie beeinflussen sie die heutige Forschung?
Katharina Rebay-Salisbury: Frauendarstellungen in der Archäologie – insbesondere altsteinzeitliche Figuren wie die Venus von Willendorf – prägen unser Bild der Menschen in der Urgeschichte. Da es aus dieser Zeit keine schriftlichen Quellen gibt, sind es vor allem bildliche Darstellungen, die uns Hinweise darauf geben, wie Menschen damals aussahen, wie sie sich kleideten, welche Frisuren sie trugen und wie sie lebten. Auffällig ist, dass in der Steinzeit vor allem Frauen dargestellt werden – Frauen unterschiedlichen Alters, teilweise schwanger –, sie zeigen die ganze Bandbreite des Weiblichen.
Diese Figuren sind Kunstwerke; sie werden rein als Darstellungen konzipiert und hatten offenbar keine andere Funktion. Was sie bedeuten und wie sie zu interpretieren sind, wird seit Beginn der Archäologie als wissenschaftliche Disziplin diskutiert. Dabei spiegeln sich oft moderne Vorstellungen in den Deutungen wider. Die materiellen Kunstwerke sprechen auch heute noch direkt zu uns – sie vermitteln Körperbilder, selbst wenn wir nicht vollständig erfassen können, was sie für die Menschen der Urgeschichte bedeuteten.
Welche Rolle spielt die Venus von Willendorf in der feministischen Kunstgeschichte, und warum ist sie für diese Ausstellung so bedeutend?
Elisabeth von Samsonow: Die Venus von Willendorf ist ein Popstar, wahrscheinlich ist sie bekannter als Michael Jackson. Das ist kein Wunder, da sie der doch recht seltene Fall einer vollständig erhaltenen und besonders schön ausgearbeiteten urgeschichtlichen Skulptur ist. In ihrer Gesichtslosigkeit – anstelle des Gesichts hat sie eine „Mütze“ oder eine Frisur – stellt sie so etwas wie den absoluten Körper dar, der alles ausspricht, was ansonsten ein Gesicht zu sagen hat. Sie ist unglaublich voluminös, wie die Erde selbst, ein großer Bauch mit noch ein wenig Zierrat dran, wie Ärmchen und Beinchen. Sie hat einfach eine große Überzeugungskraft, jeder und jede mag sie. Für die feministische und queere Geschichte steht sie für die Autonomie des Körpers, für etwas, das jenseits des antiken oder zeitgenössischen Schönheitsdiktates steht. Mit ihr kann man also eine Subversion machen, und das ist genau, was die KünstlerInnen, die sich auf sie bezogen haben, dann auch taten.
Wie haben Sie beide Ihre unterschiedlichen Perspektiven in der Ausstellung vereint, um eine sinnvolle Symbiose zu schaffen?
Katharina Rebay-Salisbury: Das war gar nicht so schwierig. Wir kannten uns schon eine Weile, und auch wenn wir bei der Interpretation der Figuren nicht immer dieselben Ansichten vertreten, teilen wir die Bewunderung und Ehrfurcht gegenüber der urgeschichtlichen Kunst. Mir als Wissenschaftlerin ist es wichtig, die Grenzen unserer Erkenntnis über die Figuren klar zu benennen. Ohne schriftliche Quellen wissen wir nicht, was sie in der Urgeschichte wirklich bedeuteten. Wir können aus Fundkontexten und Verbreitung Vermutungen anstellen – ob es sich aber um Göttinnen, Erotika, Hebammenhilfen, Heiratssymbole oder etwas ganz anderes handelt, bleibt offen. Das heißt aber nicht, dass wir uns heute in der Interpretation einschränken müssen – jede und jeder darf in diesen Figuren lesen, was sie oder er darin sieht.
Frau von Samsonow, Sie sprechen von einem „Experiment“, das längst fällig war – was macht diese Ausstellung zu einem solchen Experiment?
Elisabeth von Samsonow: Das Experiment, archäologische Funde mit weiblicher Markierung und zeitgenössische Kunst dazu auszustellen, ist bereits des Öfteren gemacht worden, von großen Museen werden derzeit ähnliche „Göttinnenausstellungen“ ausgerichtet. Jedoch, meistens wird nur auf den antiken oder klassischen Kanon der Göttinnen aus den Antikensammlungen zurückgegriffen. Österreich ist aber nun weltweit bekannt für seine hohe Funddichte an herausragenden urgeschichtlichen weiblichen Figurinen, deren Aneignung durch die Kunst bereits wieder ein eigenes Kapitel ist.
Hier, in diesem Land und an diesem Ort, macht es für mich besonders Sinn, eine solche Ausstellung zu konzipieren. In den Räumen für die Sonderausstellungen im Schloss Asparn a.d. Zaya ist zwar nur eine Kabinettausstellung möglich gewesen, also eine sehr konzentrierte, dichte Schau, die glänzend vom museumseigenen Team begleitet und umgesetzt worden ist. Aber sie ist durch ihre Konzentriertheit auch ein guter Denkraum, in welchem, wie in einem Studiolo, die merkwürdigen Dinge sehr direkt zu einem sprechen. Das Thema hat aber das Zeug zu einem richtigen Blockbuster in einem der ganz großen Häuser.
Welche Botschaft möchten Sie mit der Ausstellung vermitteln?
Katharina Rebay-Salisbury: (Ur-)Geschichte ist immer auch Frauengeschichte. Der Fortbestand der Menschheit ist ohne weibliche Reproduktions- und Sorgearbeit nicht denkbar. Die Frauendarstellungen der Urgeschichte rücken diesen Aspekt in den Vordergrund – einen Aspekt, der in der von Kriegen und Macht geprägten traditionellen Geschichtsschreibung oft vernachlässigt wird. Diese Darstellungen eröffnen eine weibliche Perspektive auf Geschichte und erinnern daran, dass es für eine funktionierende Gesellschaft Frauen und Männer braucht.
Alle Infos unter www.mamuz.at
_____________
Das könnte dich auch interessieren:
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
2 Min.
5 Winter-Hotspots in Salzburg, die du erleben musst
Winterzauber pur
Salzburg zeigt sich im Winter von seiner elegantesten Seite. Zwischen schneebedeckten Gipfeln, historischen Gassen und modernen Wohlfühlorten warten echte Hotspots für Genießer, Abenteurer und Ruhesuchende. DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN: Frühstückslokale in Salzburg: Unsere 5 Favorites Hochzeitstrends 2026: Live-Cooking, Kristallluster & das Comeback des Schößchens Veganes Österreich: So beliebt ist der Lifestyle wirklich 1. Zell … Continued
2 Min.
Mehr zu Freizeit