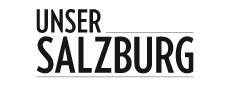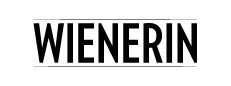Julie Delpy im Interview: Was ist ein “guter” Flüchtling?
Die Filmschaffende und Schauspielerin über ihre neueste Komödie "Barbaren - Willkommen in der Bretagne"
© Luna Filmverleih/THE FILM
Paimpont will ukrainische Geflüchtete mit offenen Armen empfangen – es kommen aber Syrer:innen. Im Interview: Die Oscar-nominierte Filmschaffende Julie Delpy über ihre neueste Komödie und Politikwissenschaftler Vedran Džihić.
“Ich hab’ sogar gelernt, Bortsch zu kochen“, sagt eine Bewohnerin. Ein Bild von Präsident Wolodymyr Selenskyj hängt an der Wand, das kleine feine Begrüßungskomitee von Paimpont steht bereit. Doch die Haut- und Haarfarbe der Familie, die aus dem Kleinbus steigt, ist dunkler als erwartet. „Was ist, wenn sie Terroristen sind?“, grübeln die Dorfjugendlichen – und zwei Frauen rätseln, ob der Esstisch raus muss, weil laut ihrer Recherche Syrer:innen auf dem Teppich sitzend essen. Kurz gefasst: Die kleine Gemeinde in der Bretagne erklärte sich bereit, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei sich aufzunehmen – sie „bekommt“ aber eine aus Syrien.
Die wunderbare und entlarvende Komödie trägt die Handschrift von Julie Delpy, die ziemlich genau vor 30 Jahren die Hauptrolle im in Wien gedrehten Kultfilm „Before Sunrise“ spielte. Für die späteren Fortsetzungen „Before Sunset“ und „Before Midnight“ zeichnete sie ebenso als Co-Autorin der Oscar-nominierten Drehbücher verantwortlich; seit 2007 führt sie auch erfolgreich Regie.
Der Titel ihres aktuellen Werks lautet „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“. Kurz vor dem Kinostart in Österreich schenkte uns die Filmschaffende, die gut die Hälfte des Jahres in Los Angeles, die andere in Europa lebt, eine warmherzige Online-Begegnung mit gesellschaftskritischen Antworten.
Womit sich ihr Film pointiert auseinandersetzt, ist eines der Forschungsgebiete des Politikwissenschaftlers Vedran Džihić; in seinem Buch „Ankommen“ (Kremayr & Scheriau) analysiert er, wie mit Angst Politik gemacht wird, was Integration braucht und bringt – ausgehend auch von einem privaten Blickwinkel. Ihn trafen wir ebenso zum Interview.

Das erste Mal nach Jahren
Doch zunächst zurück zu den „Barbaren“. Während die Bewohner:innen von Paimpont also damit beschäftigt sind, die Gäste auf ihre Art – etwa mit ein wenig abgelaufenen Lebensmitteln – willkommen zu heißen, wird dem syrischen Ehepaar bewusst: „Es ist das erste Mal nach vier Jahren, dass wir unser eigenes Zimmer haben.“ Eine schöne Szene, die erahnen lässt, was auch immer man erahnen möchte. Mit einem Augenzwinkern, wenn man mag, mit viel Tiefgang, wenn man weiterdenken mag.
Ich wollte einen hoffnungsvollen Film in all dieser Dunkelheit
Julie Delpy, Filmschaffende und Schauspielerin
machen.
„Mit dieser Szene sind wir das erste Mal bei der Perspektive der Flüchtlingsfamilie. Es war für mich essenziell, auch in ihre Realität einzutauchen“, beschreibt Julie Delpy. Gemeinsam mit ihrem Autor:innenteam führte sie selbst Interviews – mit Geflüchteten, Organisationen, aber auch mit Gemeinden, die Schutzsuchende abgelehnt hatten. Dabei stellten sie fest: „Menschen aus bestimmten Ländern haben es viel schwerer, angenommen zu werden. Wir haben Unterschiede gesehen, eine Art Hierarchie. Wir wollten auch das zeigen, aber mit Humor. – Ich wollte einen hoffnungsvollen Film in all dieser Dunkelheit machen“, sagt Julie Delpy.
Dass sie sich mit Vorurteilen auskennt, liege nicht nur an der aufwändigen Recherche im Vorfeld. „Ich bin zwar mit politisch links orientierten Eltern aufgewachsen, aber einige andere aus der Familie gehören dem rechten Flügel an. Eine meiner Großmütter war beispielsweise zwar eine großartige Person, aber auch eine ziemliche Rassistin. Mir sind diese Charaktere also nicht fremd, ich habe viel von der rechten Ideologie mitbekommen, ohne als Kind darüber zu urteilen. Du verstehst als Kind erst mit der Zeit: Ah, das ist also Rassismus.“
Umso mehr lag es ihr am Herzen, die Dinge zurechtzurücken: „Die Menschen glauben, Flüchtlinge dringen bei uns ein, wollen uns etwas wegnehmen – unsere Jobs und unsere Frauen, wie es im Film heißt“, schmunzelt sie. „Zum Großteil ist das Gegenteil der Fall, nämlich dass uns Migrant:innen – auch wirtschaftlich gesehen – Dinge bringen.“
Befeuert wird der Mangel an Willkommenskultur durch Angst, geschürt von jenen, denen es nur um Macht und Geld geht, ist sie überzeugt. Wenn es Probleme gibt, werden Schuldige gesucht, „es ist viel komplizierter, die Fehler eines Systems zu sehen. Es ist leichter, auf Menschen wütend zu sein.“
Die Menschen dahinter
Wir leben in Zeiten großer emotionaler Erregung, beschreibt der Politikwissenschaftler Vedran Džihić, „und leider hat sich in vielen westeuropäischen Gesellschaften und den USA das Narrativ verstärkt, dass Flüchtlinge eine Bedrohung sind.“ Zuletzt sei das Thema beispielsweise im Bundestagswahlkampf durch die AfD dermaßen auf die Spitze getrieben worden, „dass man das Gefühl hatte, die Migration sei das einzige Problem in Deutschland“.

Vor diesem Hintergrund sei kein Platz für die Menschlichkeit, man vergesse, „dass hinter dem Plakativbegriff des Flüchtlings Menschen stehen, die Ängste, Hoffnungen und individuelle Biografien haben und dass der Großteil nichts anderes will, als gesehen werden“. Geht man das Thema heute an, bilden sich leider oft zwei Lager: die eine Ecke neige dazu, alles zu verteufeln, die andere eher zu glorifizieren.
Wie aber gelingt ein Dialog? – Es braucht nüchterne Analysen, auch um zu wissen, wo es blinde Flecken und Schwierigkeiten gibt, sagt Vedran Džihić, und menschliche Erzählungen. „Die Kunst liegt darin, Brücken zwischen unterschiedlichen Geschichten zu bauen, mit Zuversicht, aber auch mit klaren politischen Positionen – wie es auch Judith Kohlenberger (Migrationsforscherin und Autorin, Anm.) mit dem großen Begriff Zugewandtheit macht.“ Es gehe darum, Räume des Dialogs und der Begegnung zu schaffen: Der Kinofilm „Die Barbaren“ oder die Kabarettistin Toxische Pommes, die kürzlich das Buch „Ein schönes Ausländerkind“ veröffentlichte, tun dies mit klugem Schmäh.
Buntes, lebenswertes Europa
Vedran Džihić ist selbst als Jugendlicher mit seiner Familie vor dem Bosnienkrieg 1993 nach Österreich geflüchtet. Ausländerfeindlichkeit gab es auch damals, „aber seit 2015/16 hat sich das Ganze zugespitzt und in Europa mit einem bedrohlichen Aufstieg von politischen Bewegungen verbunden, die oft menschenverachtend agieren und an die dunklen Kapitel der Menschheitsgeschichte erinnern“, sagt er.
Dabei gelte doch prinzipiell für Europa: „Wir sind super diverse Gesellschaften mit multiplen Zugehörigkeiten – und sind dabei im weltweiten Vergleich lebenswerte Gesellschaften.“ Vielfach würden Probleme gemacht, die es gar nicht gäbe, findet er, auch in Österreich, „dem Land, das ich ins Herz geschlossen habe und das so viel bunter, offener, dynamischer wurde.“ Auch das wollte er in seinem Buch „Ankommen“ gerade jetzt festhalten.
Eine Parallele zwischen seinem Buch und Julie Delpys „Die Barbaren“ ist das Beleuchten davon, welche Unterschiede bei der Begegnung mit Geflüchteten gemacht werden. „Wenn Menschen aus demselben regionalen, auch teilweise kulturellen Kreis kommen, wenn sie der einheimischen Bevölkerung ,ähnlicher‘ sind, ist das Ankommen leichter“, erklärt der Politikwissenschaftler. „Was sich offenbar nicht abdrehen lässt: Menschen urteilen nach subjektiven Kriterien.“ Und die ließen sich instrumentalisieren.
Wir brauchen tätige Hoffnung, die sich durch die Akte von uns allen zusammenstückelt.
Vedran Džihić, Politikwissenschaftler

„Die Menschen aus Afghanistan und Syrien kamen nach Österreich, wo bereits seit Jahren von einigen negative Stimmung gegen den islamischen Glauben gemacht wurde. Objektiv macht es keinen Unterschied, ob jemand aus der Ukraine wegen eines Krieges flüchtet oder aus Syrien. Sie alle sind nicht per se da, weil sie das System ausnutzen oder jemanden bedrohen wollen. Sie flüchten, weil sie Sicherheit brauchen. Die große Mehrheit ist auch bereit, dafür viel zu leisten, was Zahlen auch klar zeigen.“
Paradeflüchtling
Welche Macht „gesellschaftliche Ausschluss- und Einschlussbrillen“ haben, musste der Politikwissenschaftler schmerzlich in der eigenen Familie erfahren. „Ich habe im Buch versucht, das Problem am Beispiel meines Vaters darzulegen: Ich bin groß, ein Basketballer, wurde erfolgreich und bin akzeptiert. Mein Vater war klein, dunkel mit einem Schnauzer, konnte nicht Deutsch und hieß Abdullah – er hatte keine Chance.“
Vedran Džihić mochte es nie, als „Paradeflüchtling“ gesehen zu werden; keine Einteilung in gut und schlecht sei förderlich und fair, „weil beispielsweise viele durch Verwundungen stärker abgehängt bleiben und nie eine neue Heimat finden können“. Migration, Integration und überhaupt die Gesellschaft können nicht das Resultat von Zufällen sein, betont er. „Wir brauchen Institutionen und politische, sozial-gesellschaftliche Maßnahmen, wenn wir Gerechtigkeit erreichen wollen.“
Julie Delpy verriet im Interview übrigens auch, dass es durchaus schwierig war, die Finanzierung für ihre Komödie „Die Barbaren“ aufzustellen. „Es hieß: Ein Film über Geflüchtete – wen interessiert das? Es ist aber nicht nur ein Film über Geflüchtete, er handelt genauso von uns“, betont sie.
Ein Gedanke von der Migrationsforscherin und mehrfach preisgekrönten Autorin Judith Kohlenberger dazu: „Wie wir mit denen umgehen, die von außen kommen, sagt etwas darüber aus, wie wir im Inneren miteinander leben.“ Werden die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten, passieren in weiterer Folge – das zeige sich beispielsweise in Ungarn oder Polen – Einschnitte bei LGBTQI-Rechten, bei der Presse- und Medienfreiheit oder den reproduktiven Rechten der Frauen, sagte sie in einem früheren Wienerin-Gespräch.
Tätige Hoffnung
Wir stehen vor großen Herausforderungen, wie es sie seit 1945 nicht gab, ist der Politikwissenschaftler Vedran Džihić überzeugt. „Heute ist nichts mehr garantiert, nicht die liberale Demokratie, der Frieden, die gesunde Natur oder der Wohlstand.“ Die Basis für ein gutes gemeinsames Weitergehen seien kritische und faktenbasierte Zuversicht und Hoffnung.
„Wir brauchen eine tätige Hoffnung, die Praktiken im Alltag und im gesellschaftlichen Leben entstehen lässt. Wenn man Trennlinien innerhalb der Gesellschaft zieht, wird uns das nicht gelingen. Wenn in Wien mehr als ein Drittel nicht wählen kann und die Migrant:innen auf der anderen Seite bleiben, wird es uns nicht gelingen. Ebenso wenig, wenn es eher Sündenböcke gibt, gegen die wir losziehen“, kritisiert er.
Sein positiver Appell: „Es liegt nicht nur, aber schon auch an den Einzelnen, dass das für uns alle gut geht. Wir brauchen für eine freundliche, freundschaftliche, vertrauenswürdige, zugewandte, demokratische Gesellschaft die praktische Hoffnung, die sich durch die Akte von uns allen zusammenstückelt. Angefangen mit diesem Interview über die Begegnungen in der Nachbarschaft bis hin zur Schule – und über alle gesellschaftlichen Schichten.“