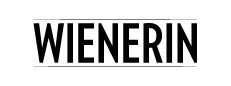© Shutterstock
Herzinfarkt, Hirntumor, Schlaganfall: Wer an Hypochondrie leidet, hat ständig Angst, ernsthaft krank zu sein. Wann die Sorge um die eigene Gesundheit problematisch wird – und was Betroffenen wirklich hilft.
Nervös stolpert Romain Faubert durch die Straßen von Paris, bewaffnet mit einem Arsenal an Desinfektionsmitteln und immer auf der Suche nach dem nächsten potenziellen Krankheitserreger. Panisch reagiert der Protagonist der französischen Komödie „Der Super-Hypochonder“ auf jedes kleinste Symptom, aus Angst, ernsthaft krank zu sein. Sein titelgebendes Verhalten wirkt auf Außenstehende urkomisch und bietet damit idealen Bühnenstoff – das wusste schon Molière.
Ernstes Leiden
Dabei ist Hypochondrie für Betroffene alles andere als lustig. Betroffene fühlen sich oft hilflos und missverstanden, während ihr Leben zunehmend von einer Angst bestimmt wird, die rational nicht zu erklären, geschweige denn zu kontrollieren scheint. Wie entsteht die psychische Erkrankung, und welche Therapieansätze können helfen? Psychotherapeutin Cornelia Schütz gibt Antworten.

Wie unterscheidet sich eine hypochondrische Störung von einer „normalen“ Sorge um die eigene Gesundheit?
Cornelia Schütz: Ich denke, das kennen viele von uns: Man hat ein körperliches Symptom oder geht zum Arzt und erhält einen Befund, der nicht ganz eindeutig ist. Entdeckt man etwa als Frau einen Knoten in der Brust, löst das sofort die Angst aus, schwer, vielleicht sogar lebensbedrohlich erkrankt zu sein. Für jemanden, der an Hypochondrie leidet, ist diese Angst nahezu alltäglich. Diese Personen haben ständig die Befürchtung, schwer krank zu sein, selbst bei gewöhnlichen Symptomen wie Kopf- oder Bauchschmerzen. Sie neigen dazu, sofort das Schlimmste zu vermuten.
Der Unterschied zur normalen Angst besteht darin, dass diese Menschen auch nach einem beruhigenden Arztbesuch schnell wieder in ihre Angst zurückfallen. Selbst wenn ein Knoten in der Brust per Mammografie und Ultraschall als harmlos diagnostiziert wird, bleibt die Sorge bestehen, dass etwas übersehen wurde. Betroffene recherchieren dann im Internet und finden Geschichten über Fehldiagnosen, was ihre Angst erneut anheizt. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Bergwanderung und haben das Gefühl, dass Ihr Kopfschmerz von gestern vielleicht ein Hirntumor sein könnte.
Diese Gedanken können so extrem werden, dass man glaubt, es könnte die letzte Wanderung sein, die man macht. Das ist nicht nur belastend, sondern auch oft sehr beschämend für die Betroffenen. Die Covid-Pandemie hat diese Ängste zusätzlich verstärkt. Plötzlich waren wir alle permanent mit der Frage beschäftigt, ob und wie man sich infizieren könnte und auf welche Symptome wir achten sollten. Das hat die Situation für Menschen mit Hypochondrie nicht einfacher gemacht.
Welche Auswirkungen hat Hypochondrie auf den Alltag von Betroffenen?
Wenn man ständig Angst hat und das Gefühl, dass etwas übersehen wird, dann bindet das enorm viel Zeit, Lebensfreude und Energie. Hypochondrie ist oft mit depressiven Symptomen verbunden, was dazu führt, dass man das Leben nicht mehr genießen kann.
Ein bekanntes Phänomen ist das sogenannte „Doktor-Shopping“, bei dem Betroffene von einem Arzt zum nächsten laufen und oft schlechte Erfahrungen machen, weil Ärzt:innen irgendwann ungeduldig werden. Wenn man zum fünften Mal ein MRT verlangt, schwindet das Verständnis. Dadurch fühlen sich Betroffene nicht ernst genommen und suchen weiter nach jemandem, der:die sie versteht.
Dieses Verhalten kann sich auf die Arbeit, aber auch auf den Freundes- und Bekanntenkreis auswirken, besonders in schweren Fällen. Hier stoßen Betroffene oft auf wenig Verständnis, was dazu führt, dass sie sich zurückziehen und sich schämen. Es macht ihnen keinen Spaß mehr, gemeinsam ins Kino oder essen zu gehen, weil die Angst ständig präsent ist.

Wie entsteht eine hypochondrische Störung – und wer ist besonders anfällig dafür?
Bei der Hypochondrie geht es meist darum, eine tief verwurzelte Angst zu binden. Betroffene haben das Gefühl, dass sie die vermeintliche körperliche Erkrankung besser kontrollieren können als die darunterliegende Angst. Die Auslöser können sehr unterschiedlich sein.
Ein klassisches Beispiel ist, wenn man in der Kindheit oder Jugend jemanden im nahen Umfeld hatte, der schwer erkrankt oder sogar gestorben ist. Solche traumatischen Erlebnisse können tiefgreifende Ängste auslösen, besonders wenn man damals nicht ausreichend begleitet wurde.
Es kann aber auch sein, dass man aus einem Umfeld kommt, in dem die Eltern viel Sorge um ihre eigene Gesundheit haben – diese Ängstlichkeit kann sich auf die Kinder übertragen und ihnen das Gefühl geben, dass sie immer auf das Schlimmste vorbereitet sein müssen. Auch psychische Verletzungen und Traumata können, auch wenn sie vordergründig klein wirken, eine Rolle spielen.
Sie können dazu führen, dass sich Betroffene ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Ganz allgemein ist Hypochondrie zudem oft mit der Angst verbunden, dem Leben nicht gewachsen zu sein und sich in Beziehungen oder im Arbeitsalltag nicht behaupten zu können. Der Schutzmechanismus, der normalerweise hilft, sich abzugrenzen, ist bei diesen Menschen oft brüchig.
Ab wann sollte man sich Hilfe holen?
Früher! Wenn diese Ängstlichkeit nur einmalig oder für eine begrenzte Zeit auftritt, ist das noch kein Grund zur Sorge. Aber wenn sie über mehrere Monate hinweg anhält oder man merkt, dass ein Symptom verschwindet und sofort das nächste auftaucht, sollte man aufmerksam werden.
Menschen mit Hypochondrie haben oft einen langen Leidensweg hinter sich. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Hilfe zu suchen, weil die Angst sonst zur Gewohnheit werden kann.
Unser Gehirn mag Gewohnheiten, selbst wenn sie schlecht für uns sind. Wenn man monate- oder jahrelang in dieser chronischen Sorge gefangen ist, wird es immer schwieriger, da herauszukommen. Was als Trampelpfad im Gehirn beginnt, kann zu einer Straße und schließlich zu einer Autobahn werden. Man spürt ein Jucken und denkt sofort an das Schlimmste, oder man schwitzt nachts und glaubt, es sei ein Karzinom.
Darum ist es wichtig, sich nicht zu schämen und nicht zu denken, man müsse das alleine bewältigen. Manchmal können Freund:innen oder ein:e einfühlsame:r Ärzt:in dabei helfen, das Problem zu erkennen und zuzuordnen.
Was als Trampelpfad im Gehirn beginnt, kann zu einer Straße und schließlich zu einer Autobahn werden.
Psychotherapeutin Cornelia Schütz
Sind häufige Arztbesuche bei Menschen mit Hypochondrie überhaupt sinnvoll, oder verstärken sie das Problem nur?
Diese ständigen Rückversicherungen bringen letztlich keine langfristige Lösung. Sie mögen für ein paar Minuten oder vielleicht ein paar Tage Erleichterung bringen, aber normalerweise nicht länger. In der Therapie ist es deshalb ein Ziel, die Arztbesuche zu reduzieren und zu lernen, mit der zugrundeliegenden Angst umzugehen, sie auszuhalten.

Ich kann mir die Antwort schon denken, aber: Hilft das Googeln von Symptomen und der Austausch in einschlägigen Online-Foren, oder verstärkt sich die Problematik dadurch nur?
Manche Betroffenen meiden Foren komplett, weil sie zu viel Angst vor den Inhalten haben, während andere ständig googeln und nach Informationen suchen. Das Problem ist, dass das Internet oft eine verzerrte Realität zeigt. Gesunde Menschen googeln ihre Symptome auch, aber sie suchen oft nach beruhigenden Informationen. Bei hypochondrischen Personen ist das anders. Sie neigen dazu, selektiv zu lesen und nehmen vor allem die schlimmsten Szenarien wahr.
Dazu kommt, dass man im Internet selten Geschichten von Menschen liest, die harmlose Diagnosen erhalten haben. Stattdessen dominieren die Katastrophenberichte: etwa, wie jemand durch leichten Kopfschmerz seinen Hirntumor erkannt hat. Das verzerrt die Realität und verstärkt die Ängste. Und man verliert leicht den Blick dafür, dass Symptome auch harmlos sein können. Also würde ich sagen: Das Internet ist ein zweischneidiges Schwert und sollte mit Vorsicht genossen werden.
Wie verläuft eine Hypochondrie-Therapie in der Regel?
In der Psychotherapie geht es zunächst darum, die persönliche Geschichte und den Lebenslauf zu verstehen und die eigenen Stärken und Ressourcen zu entdecken – also zu schauen, wie man schwierige Zeiten bereits früher gemeistert hat. Dabei kann man Bewältigungsstrategien erkennen, die durch die ständige Angst in den Hintergrund gedrängt wurden. In weiterer Folge identifizieren wir aktuelle Belastungen und Konflikte im Leben des:der Betroffenen.
Außerdem gilt es zu verstehen, was die Angst einem sagen will. Wo gibt es Defizite, oder in welchen Bereichen lebe ich nicht nach meinen Wünschen und Bedürfnissen? Diese Erkenntnisse können schon viel Entlastung bringen. Ein weiterer Aspekt ist, alte Verletzungen zu verarbeiten, um zu verstehen, wie diese einen geprägt haben. Der Körper wird hier einbezogen, um zu spüren, was damals gefehlt hat und was heilsam wäre. Schließlich erlernen wir in der Therapie, wie es gelingen kann, sich zu entspannen und sich etwas Gutes zu tun und nicht immer so fies mit sich selbst umzugehen.
Hypochondrische Menschen haben oft Schwierigkeiten, Genuss zuzulassen. Hier braucht es immer wieder die Bekräftigung, dass es in Ordnung ist, auch mal zu genießen, sich eine Pause zu gönnen und die schönen Dinge des Lebens wahrzunehmen. Und manchmal innerlich die Angst an der Hand zu nehmen und zu sagen: „Stopp. Danke, liebe Angst, dass du dich um mich kümmern willst, aber jetzt übernehme ich das.“ In schweren oder besonders langwierigen Fällen kann auch eine begleitende medikamentöse Unterstützung mit Psychopharmaka sinnvoll sein.
Gibt es Techniken oder Strategien, die HYPOCHONDRIE-Betroffene im Alltag anwenden können, um ihre Ängste zu reduzieren?
Ich habe einmal gelesen: „Du solltest jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen – außer du hast gerade Stress, dann eine Stunde.“ Das ist ein wunderbarer Ansatz, was die Selbstfürsorge betrifft. Denn gerade in herausfordernden Zeiten ist es essenziell, sich bewusst Inseln der Ruhe zu schaffen.
Es gibt zahlreiche feine Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, die dabei helfen können, positive Körpergefühle wieder wahrzunehmen. Sich zum Beispiel in die Badewanne zu setzen und bewusst hinzuspüren, was sich gut anfühlt, ist ein einfaches, aber effektives Mittel und kann dabei helfen, den Fokus umzulenken und die Ängste beiseitezuschieben.
Das könnte dich auch interessieren:
- Demenz: Über den Kampf gegen das Vergessen
- Die Angst vor Veränderung – und wie wir damit umgehen lernen
- Yoga: Herz über Kopf
Mehr über die Autorin dieses Beitrags:

Andrea Lichtfuss ist Stv. Chefredakteurin der TIROLERIN und für die Ressorts Beauty, Style und Gesundheit zuständig. Sie mag Parfums, Dackel und Fantasyromane. In ihrer Freizeit findet man sie vor der X-Box, beim Pub-Quiz oder im Drogeriemarkt.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
4 Min.
So prägt 2026 die Welt der Frauengesundheit
Weg von Tabus, Unsichtbarkeit und Symptombehandlung – hin zu ganzheitlichem Wohlbefinden über alle Lebensphasen hinweg
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Körperliches Wohlbefinden, mentale Stärke, Ernährung, Bewegung und die Fähigkeit, mit dem eigenen Körper in Austausch zu treten: Dieses ganzheitliche Verständnis von Gesundheit spiegelt sich in einer Reihe aktueller Entwicklungen wider, die zeigen, wie wir Gesundheit selbstbestimmt, individuell und zukunftsorientiert leben. Den Zyklus verstehen Der weibliche Zyklus ist … Continued
4 Min.
Gesundheit
5 Min.
Die Zukunft der Pflege in NÖ: Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Interview
Ein Ausblick
2026 steht in Niederösterreich ganz im Zeichen der Weiterentwicklung des Pflegesystems. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Interview. Niederösterreich ist in den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels mit mehr pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel konfrontiert. Herausforderungen, denen sich Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Soziales und Wohnbau, durchaus bewusst ist und denen das Land NÖ … Continued
5 Min.
Mehr zu Gesundheit