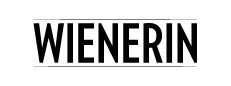© Privat
Ihre Geschichte begann an dem Tag, als ihr Vater in Papua das Volk der Fayu entdeckte. Ein Stamm ohne Kontakt zur Außenwelt, bei dem sie aufgewachsen ist. Nun trägt sie die Mentalität zweier Kulturen in sich, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Stammesfrau und Weltbestsellerautorin. Ein Gespräch über ein nahezu unglaubliches Leben.
Sabine wurde am 25. Dezember 1972 in Nepal geboren, wo ihre Eltern als Sprachwissenschaftler und Missionare mit einem kleinen Stamm, den Danuwari, nahe der indischen Grenze lebten. Kurz vor ihrem vierten Geburtstag musste die Familie mit drei Kindern aus politischen Gründen das Land verlassen und nach Deutschland zurückkehren – bis sie wenige Monate später die Reise in eine neue, aufregende Welt antraten: von den höchsten Gipfeln der Welt in das tiefe, sumpfige Gebiet der indonesischen Insel Neuguinea im Südpazifik.
Eine magische Welt
Auf seiner Expedition entdeckte ihr Vater Klaus-Peter den Stamm der Fayu. „Als mein Vater aus dem Kanu ausstieg, trat ein Mann aus dem Dschungel, die wildeste Erscheinung, die er je gesehen hatte. Die Nase des Mannes war von langen Knochen durchbohrt, sein Kopf mit Federn geschmückt und sein Körper mit einer Substanz eingerieben, die schrecklich roch“, und dennoch wurde ihr dieser Stamm im „Verlorenen Tal“, der sich damals in einem schrecklichen Krieg befand, zur Heimat.
Ein Stamm, der seine Toten nicht begräbt, sondern mit den Leichen zusammenlebt, bis sie vollständig verwest sind. Als Zeichen der Trauer reiben sie sich mit den Flüssigkeiten, die aus den Leichen austreten, ein. Ein Stamm, der die Gemeinschaft und den Zusammenhalt über die individuellen Bedürfnisse stellen muss, um zu überleben.
Eine Kindheit, in der Sabine lernen muss, „unsichtbar“ zu sein, ihre Sinne für alle Gefahren des Urwalds geschärft werden, sie das Jagen mit Pfeil und Bogen erlernen darf, da sie die Eingeborenen vorerst für einen Jungen halten. Ein Leben, das der wilden Natur untergeordnet ist, vom Sonnenaufgang bis zum -untergang. „Es gab kein Gestern und kein Morgen, nur die nie enden wollende Gegenwart. Mein Geist war frei wie ein Vogel, alles pulsierte mit Energie, die Schönheit der Natur versetzte mich in endloses Staunen. Es war ein Leben, das perfekt zu mir passte. Ich hatte eine zauberhafte und wunderschöne Kindheit und Jugend.“
Ein Leben, das aber auch brutale Facetten in sich birgt, bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Rache, Vergeltung, Kindermorden und Kannibalismus. Diese Geschichte erzählt sie, aus der Sicht des Kindes in ihrem Buch „Dschungelkind“, welches innerhalb von nur zwei Jahren in über 30 Sprachen übersetzt und zum Weltbestseller wurde.

Kulturschock
Kurz vor ihrem 18. Geburtstag verließ sie die Welt ihrer Kindheit, denn ihr Onkel hatte sie in einem Schweizer Internat angemeldet, damit sie einen Schulabschluss machen kann. „Es war bitterkalt, als ich mit meinem Koffer am Hamburger Bahnhof ankam. Ich fror, hatte keine winterliche Kleidung, keine Handschuhe, keine Mütze“, und der Lärm der Menschenmassen versetzte sie in Panik. Im Dschungel sah sie nicht nur mit den Augen, sie nahm die Umgebung mit all ihren Sinnen wahr, spürte ungefiltert die Stimmungen der Menschen. Nun, im Westen, reagierten ihre Sinne vollkommen über, denn sie spürte intuitiv, wenn sich ihr Gegenüber verstellte, sich hinter einer Fassade versteckte, log.
Ist ihr diese Gabe nach wie vor anstrengend? „Ich kenne es ja nicht anders und bin daran gewöhnt“, sagt sie, „aber tatsächlich ist es Fluch und Segen zugleich. Manchmal ist es belastend, alles zu spüren, was mein Gegenüber fühlt, weil ich dabei auch in menschliche Abgründe blicke, die schwer zu ertragen sind. Aber es ist eine große Gabe, die mir Dinge zeigt, die anderen verborgen bleiben.“
Im Internat träumt sie bald von ihrem Zuhause in Papua und beschließt zurückzugehen – als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Obwohl die Freude auf ihre erste Tochter groß ist, ist sie gleichzeitig am Boden zerstört. In den folgenden Jahren bekommt sie noch drei Kinder aus zwei Ehen, die beide scheitern. Und es sind schließlich ihre vier Kinder, die ihr die Kraft geben, auf die Suche nach Heilung zu gehen, als sie todkrank wird, befallen von einem unbekannten Parasiten, der sie aufzufressen droht.




Der Kampf ums Überleben
„Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und versuchte, klar und logisch zu denken. Hier im Westen konnte man nichts mehr für mich tun. Wenn ich mir diese Krankheit aber tatsächlich im Dschungel eingefangen habe, dann würde ich vielleicht bei den Stämmen von Neuguinea Heilung finden. Ich stand vor der Wahl, die letzten Monate meines Lebens mit meinen Kindern zu verbringen und sie auf meinen Tod vorzubereiten. Oder alles auf eine Karte zu setzen, um Heilung zu finden. Um mir eine kleine Chance zu geben, zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen, heiraten und eigene Kinder haben.“
Und sie trifft eine Entscheidung, die ihr das Herz bricht: Sie bringt die Kinder zu ihren Vätern und kehrt zurück in den Dschungel. Haben ihre Kinder diese Entscheidung verstanden? „Ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich todkrank bin – um sie zu schützen. Jeden Morgen aufzuwachen, ohne zu wissen, ob ihre Mutter noch lebt, das wollte ich ihnen nicht zumuten. Heute kennen sie die ganze Geschichte und sind dankbar, dass am Ende alles gut ausgegangen ist. Sie damals zurückzulassen, war die schmerzhafteste Entscheidung meines Lebens, aber es war auch meine einzige Chance, gesund zu ihnen zurückzukehren.“ Damals ahnte sie nicht, dass die Reise, um ein Heilmittel zu finden, fünf Jahre dauern sollte.
Eine Reise, die so abenteuerlich und unglaublich ist, die sie in den tiefsten Urwald von Papua-Neuguinea und auf die Salomon-Inseln führte und die sie schonungslos offen in ihrem neuen Buch „Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind“ schildert.


Heilung
„Meine Eingeweide fühlten sich an, als seien sie zu Tausenden engen Knoten gewickelt. Mir war heiß, als stünde ich in Flammen. Ich erinnere mich an die Krämpfe der Muskel, an das Erbrechen von Blut, das meine Decke rot färbte, an die stechenden Kopfschmerzen, die so stark waren, dass ich meinen Kopf auf den Boden schlagen wollte. Ich fühlte mich wie in der Hölle, bettelte, weinte, schrie um Linderung, bis ich wieder in die Dunkelheit zurückfiel.
Im Hintergrund hörte ich Trauergesänge; der ganze Stamm hatte sich draußen versammelt, um mir die letzte Ehre zu erweisen und meine Seele ins Jenseits zu schicken“, schreibt Sabine über eine Woche zwischen Leben und Tod, nachdem man ihr die bittere Medizin löffelweise eingeflößt hatte. Ein Medizinmann, der sehr abgelegen in den Bergen lebte, hatte schließlich ein Gegengift, das wirkte: Aus dem blutroten Harz zweier Baumrinden pressten sie einen Saft, der die Parasiten in ihrem Körper abtötete. Nach einem Monat konnte sie wieder laufen und den Weg zurück ins Leben antreten.

Das Leben im Westen
Ging es im Regenwald darum, sich in den festen Strukturen eines Stammes körperlich zu schützen, musste Sabine Kuegler in der westlichen Zivilisation lernen, sich emotional zu schützen. Ob ihr das gelungen ist? „Lange Zeit konnte ich das nicht, aber inzwischen bin ich ganz gut darin. Ich habe nun verstanden, dass ich im Westen frei und selbstbestimmt bin. Ich habe die Angst abgelegt, als Individuum sichtbar zu werden und für mich einzustehen“, gibt sie in ihrer ruhigen Art zu.
Im Urwald wusste sie bald, wo die Krokodile sind, und schwamm nicht mehr in deren Revier. Hat sie nach ihrer Rückkehr gelernt, die „westlichen Krokodile“ zu erkennen? „Bei diesen ‚Krokodilen‘ geht es um kulturelle Missverständnisse. ‚Das weiß doch jeder‘ ist ein Satz, den ich unzählige Male gehört habe. Ich sehe ja aus wie eine Europäerin, bin aber innerlich eine Stammesfrau.
Die Menschen um mich herum haben nicht verstanden, dass ich so vieles, was hier ganz selbstverständlich ist, nicht kannte oder wusste. Dadurch habe ich mich hier lange nur sehr schwer zurechtgefunden. Heute passiert mir das immer seltener. Gerade auch, weil ich während der fünf Jahre, die ich zuletzt im Urwald verbracht habe, sehr viel über die kulturellen Unterschiede und auch über mich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste.“ Es ist ihr also gelungen, die Stammesfrau in ihr loszulassen?
„Ich möchte die Stammesfrau in mir gar nicht loslassen, denn sie ist ein wichtiger Teil von mir. Meine Aufgabe ist es, hier als Stammesfrau klarzukommen, und darin werde ich immer besser.“ Und wie steht es um dieses besondere Gefühl der Freiheit, das sie in Papua erlebt hat? Kann man diese auch im Westen erlangen?
Die überraschende Antwort: „Das kann man nur hier im Westen. Die Menschen im Stamm sind nicht frei, ihren Lebensweg selbst zu bestimmen. Sie bezahlen die emotionale Sicherheit, die Geborgenheit und den bedingungslosen Schutz durch die Gemeinschaft mit persönlicher Unfreiheit. Ich musste das erst verstehen und lernen, die Verantwortung, die ich hier für mein Leben selbst tragen muss, anzunehmen.
Inzwischen genieße ich das Leben hier sehr.“ Wird sie ihren Kindern die Orte ihrer Kindheit je zeigen? „Vielleicht eines Tages. Aber meine Kinder sind im Westen geboren, hier aufgewachsen, und sie haben ihren Lebensmittelpunkt hier.“



Mittlerin der Kulturen
In einem Interview mit dem NDR hat Sabine den Urwald mit drei Worten beschrieben: „mächtig, wild und heilend“. Welche Attribute würde sie unserem Leben hier zuordnen? „Bequem, vielfältig, chancenreich.“ Vielleicht hat sie ja mit ihrem Vertrauten Micky, der für sie über die Jahre den eigenen Stamm als Oberhaupt verlassen hat, um sich mit ihr auf die Suche nach einer heilenden Medizin zu machen, die Chance, in Zukunft zu einer Mittlerin der beiden Kulturen, die sie in sich trägt, zu werden?
„Wir sind weiter ständig in Kontakt und haben viele neue gute Ideen, die wir hoffentlich irgendwann umsetzen werden“, beschreibt sie ihre Pläne. „Für mich ist das der Weg, zu verstehen, zu begreifen, wer ich wirklich bin, die Teile noch einmal zusammenzusetzen. Ich weiß jetzt, dass ich alles, was das Leben von mir verlangt, mit Selbstvertrauen und Kraft bewältigen kann.“ Die Freiheit dazu hat sie hier im Westen.
Wie schrieb Perikles bereits im 5. Jahrhundert vor Christus? „Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Zum Glück brauchst du Freiheit, zur Freiheit brauchst du Mut.“ Und den hat Sabine Kuegler.